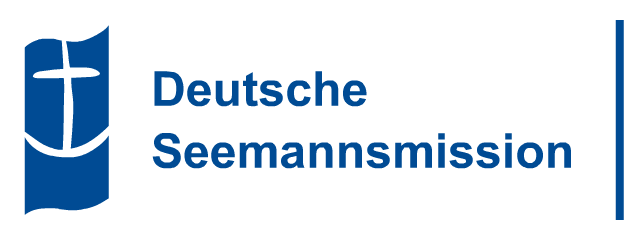Im Nationalsozialismus geriet der christliche Charakter der Seemannsmission unter ideologischen Druck: Der „Zweckverband Deutsche Evangelische Seemannsmission“ fügte sich zwar ein in die Vereine der Inneren Mission. Die Arbeit der Seemannsmission setzte jedoch während des Kriegs aus. Nach Kriegsende waren viele Häuser zerstört oder dienten anderen Zwecken. Auch fehlte die Notwendigkeit der Fürsorge, da die Handelsflotte durch Kriegsverluste und Ablieferungen an Alliierte klein war und die Zahl der aus Internierung oder Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Seeleute nur langsam wuchs. Das änderte sich mit dem Wirtschaftswunder in den 50er Jahren.
Wirtschaftswunder
Die Vereine als Träger der Seemannsmission organisierten sich in Nachkriegsdeutschland neu im Zweckverband „Deutsche Seemannsmission e.V.“ in Bremen. Der Bedarf wuchs analog zum Wachstum der deutschen Industrieproduktion – und des Außenhandels. Die deutsche Seefahrt erreichte 1970 einen Höchststand ihrer Nachkriegskonjunktur: Unter deutscher Flagge fahren 56.441 Seeleute. Entsprechend groß war die Nachfrage nach Betten und Betreuung in Seemannsheimen – mit einem Unterschied zu früher. Bisher lag der Fokus auf deutsche Seeleute. Das änderte sich.
Denn: Der weltumspannende Handel erfasste auch die Beschäftigung – bevor von Globalisierung die Rede war. In der Folge stieg die internationale Herkunft der Seeleute – gleichzeitig sank sukzessive deren Zahl. Die Deutsche Seemannsmission reagierte und konzipierte das Format des Internationalen Seemannsclubs, etwa den Duckdalben in Hamburg oder Welcome in Bremerhaven. Diese Einrichtungen stehen für jeden ohne Einschränkung offen, ungeachtet des religiösen Bekenntnisses, ethnischer Zugehörigkeit oder Nationalität. Auf internationaler Ebene vernetzen sich die Seemannsmissionen 1968 in der „International Christian Maritime Association“, ICMA.
Containerisierung
Zäsuren in der (see-)wirtschaftlichen Entwicklung bedeuten Ölkrise, Containerisierung, Dollarverfall, Werften Krise. Die Zahl der westdeutschen Seeleute sinkt seit 1972 bis 1988 auf 14.000, Anfang des neuen Jahrtausends sind es knapp über 9.000. Die ökonomischen Bedingungen forcieren zudem den strukturellen Wandel, der sich durch Ausflaggung, Zweitregister aber auch durch Hochtechnisierung und Verkleinerung der Crews kenntlich macht. Nun kommt den Seemannsheimen auch die Aufgabe zu, Seeleute im Übergang in einen neuen Beruf zu betreuen. Auf der anderen Seite werden Besatzungsmitglieder aus Niedriglohnländern zum Bordeinsatz nach Hamburg eingeflogen- auch ihnen bieten die Seemannsheime Übernachtung. Erst Ende der 90er Jahre sinkt die Nachfrage der Seeleute nach Übernachtungen. Die Zahl der deutschen Seeleute geht zurück und Besatzungen aus Nicht-EU-Staaten haben nach dem Schengener Abkommen kein Bleiberecht in Deutschland mehr.
Globalisierung
Das Seemannsheim am Krayenkamp betreut noch 1970 fast nur deutsche Seeleute. Die meisten Ausländer stammen aus Österreich. Bereits in den 80er Jahren sind im Jahresschnitt Seeleute aus 60 Nationen im Krayenkamp, aus der Türkei, von den Philippinen, aus Indonesien, von den Kap Verden, Spanien, Ghana, Burkina Faso, aus Indien, Pakistan. Mit dem Ende des kalten Krieges kommen Seeleute aus Russland oder der Ukraine hinzu. Sie arbeiten als Mannschaft, während Schiffsoffiziere meist aus dem Land der Reederei oder des Flaggenstaates kommen. Für die Seeleute heißt das: Weniger Kommunikation, mehr Isolation und Vereinsamung.
Anfang der 1990er Jahre bleiben im Seemannsheim zum ersten Mal Betten frei. 1996 öffnet sich 1996 das Haus für die ersten Touristen. Einen noch weitergehenden Strukturwandel der maritimen Wirtschaft und der Aufgaben eines Seemannsheims bedeutet der Einsatz des Containers. Anfang der siebziger Jahre wird der Container zum hocheffizienten Transportformat des Welthandels: Mit Folgen für die Crews. Auf einem Stückgutfrachter in großer Fahrt arbeiten etwa 40 Besatzungsmitglieder. Ein Containerschiff ersetzt vier konventionelle Frachter und fährt mit 12 bis 20 Mann. Der quantitative Wandel setzt sich auch qualitativ um. Das Schlüsselwort heißt: Mehrzweckeinsatz. Bisher differenzieren sich die traditionellen Berufe an Bord in Decksdienst, Maschinendienst und Bedienung. Der Mehrzweckeinsatz verschmilzt nun die historischen Gegensätze von Deck und Maschine. Die Arbeit für den Einzelnen wird komplexer. Die Belastung durch verdichtete Arbeit wird höher. Die Containerisierung der Stückgutverkehre und die Automatisierung der Umschlageinrichtungen führen zudem zu extrem kurzen Hafenliegezeiten – und damit zu einer Nachfrage nach hochverdichteter Betreuung in einem Seemannsheim für aktive Seeleute. (hri)